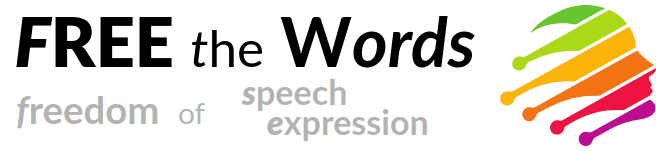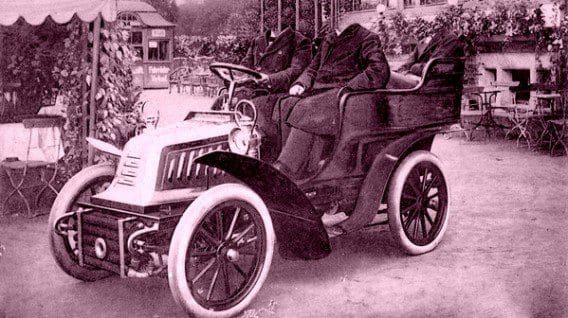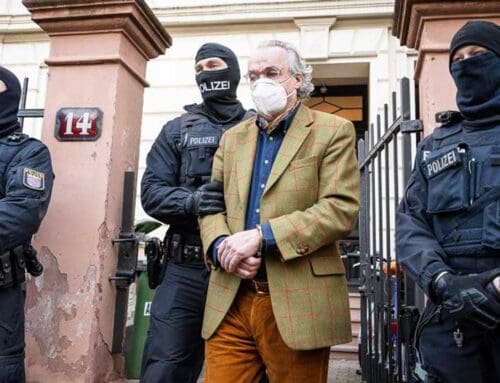Das Ende des Krabbenbrötchens?
Die zerstörerischen Schleppnetze der Wattenfischerei dezimieren die Biodiversität in dieser Meeresregion enorm – auch in den Nationalparks. Doch die örtlichen Politiker und Tourismus-Vertreter wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Autor ist engagierter Naturschützer und schildert in diesem Beitrag die Problematik.
Ein Brötchen mit Krabbenfleisch gehört zum Muss in einem Nordseeurlaub. Das könnte sich bald ändern, oder auch nicht. Nun solle Schluss sein mit dem Krabbenfischen (Garnelen) in Meeresschutzgebieten, zu denen auch die Wattenmeer-Nationalparke als Natura-2000-Gebiete gehören, hieß es zunächst von der EU-Kommission in Brüssel.
Die Kommission legte dazu 2020 einen Aktionsplan für eine nachhaltigere Fischerei in der „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030“ vor:
„Naturschutz: zentrale Verpflichtungen bis 2030
1.Gesetzlicher Schutz von mindestens 30 % der Landfläche und 30 % der Meeresgebiete der EU und Integration ökologischer Korridore als Teil eines echten transeuropäischen Naturschutznetzes; […]
3.wirksame Bewirtschaftung aller Schutzgebiete, Festlegung klarer Erhaltungsziele und ‑maßnahmen und angemessene Überwachung dieser Gebiete. […]
Erforderlichenfalls werden Maßnahmen eingeführt, die den Einsatz von für die Biodiversität u. a. am Meeresboden besonders schädlichen Fanggeräten beschränken. Die Kommission wird auch prüfen, wie der Einsatz von grundberührenden Fanggeräten mit den Biodiversitätszielen zu vereinbaren ist, da Tätigkeiten mit diesen Fanggeräten derzeit am schädlichsten für den Meeresboden sind. Dies muss auf faire und für alle gerechte Weise geschehen. Der Europäische Meeres- und Fischereifonds sollte auch den Übergang zu selektiveren und weniger schädlichen Fangtechniken unterstützen.“ (Im Detail und auf „Europadeutsch“ hier)
Das klingt gut, auf dem bedruckten Papier. Demnach soll die Fischerei mit Grundschleppnetzen – also Netzen, die den Meeresgrund berühren – in Schutzgebieten spätestens 2030 unzulässig sein. Erste Maßnahmen sollen demnach bereits bis Ende März 2024 feststehen. Die verwendeten Grundschleppnetze zerstörten die Schutzgebiete. Das führte zu Protesten der Krabbenfischer an der Nordseeküste, die um ihre Existenzgrundlage bangen.
Unterstützt werden die Fischer von Lokalpolitikern aus der Region – und den Medien; einige Kreistage stimmten in Resolutionen bereits gegen die Einschränkung – gegen EU-Subventionen für die Fischereibetriebe hat man aber nichts. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemier (B90/Die Grünen) wusste es ganz genau: „Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Krabbenfischerei schonender für den Meeresboden ist als andere Grundschleppnetzfischereien“, so der Grünen-Politiker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ja, vielleicht „schonender“, aber eben nicht schonend, und „welche wissenschaftliche Erkenntnisse“?
Die Sache mit dem Beifang
Die kleinen Fangschiffe heißen Kutter, von denen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein noch etwa 200 auf Fangfahrt gehen. Gefischt wird mit sogenannten Baumkurren. Das sind Netze, die links und rechts vom Schiff mit „Bäumen“, den Auslegern, herabgelassen werden und dann mit Rollen und Seilen über den Meeresgrund schleifen. Mit den Grundschleppnetzen wird der Meeresboden, auch im Nationalpark Wattenmeer, das als „Weltnaturerbe“ ausgewiesen wurde, ständig planiert. Der enorme Beifang veränderte schon das Artenspektrum in diesem Großschutzgebiet. Nach Angaben des WWF beträgt der Krabben-Beifang bis zu 1:9, auf einen Teil Krabben gehen bis zu 9 Teile Beifang ins Netz. Krebse, Seesterne oder Jungfische verschiedener Arten, die, weil sie keine Krabben sind, wieder über Bord gehen, tot oder verletzt, sind ein enormer Eingriff in das Schutzgebiet Wattenmeer. Möwen haben das erkannt und folgen stets den Krabbenkuttern, um den Beifang aus dem Wasser zu picken – ein beliebtes Fotomotiv für ahnungslose Touristen. Die Krabben werden an Bord gekocht und von wenigen Großhändlern aufgekauft. Untermaßige Krabben werden zu Zierfischfutter verarbeitet.
Die Zunft der Krabbenfischer verweist auf das vermeintliche „Gütesiegel“ des „Marine Stewardship Council“ (MSC), das ursprünglich vom Lebensmittelkonzern Unilever und dem WWF erfunden wurde, um die Nachhaltigkeit der Fischerei zu bestätigen; seit 1997 ist das MSC eine unabhängige und nichtstaatliche Organisation mit Sitz in London. Bis 2017 kritisierte der WWF die MSC-Zertifizierung der Krabbenfischerei wegen des enormen Beifanges, dann kippte die Umweltorganisation um und bestätigte plötzlich (zusammen mit dem Naturschutzverband NABU) die „Nachhaltigkeit“ der Garnelenfischerei; warum dieser plötzliche Sinneswandel eintrat, ist nicht bekannt. Die Stiftung Warentest empfiehlt zwar, Fischereiprodukte mit MSC-Gütesiegel zu bevorzugen, kritisiert aber gleichzeitig, dass es in der Europäischen Union zu wenig Kontrollen der Einhaltung der Kriterien gibt.
Das Crannet-Projekt (2012 bis 2015) des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei) versuchte mit ausgewählten Garnelenfischern den Beifang durch Änderung der Netzweiten im „Steert“, dem unteren Ende des Netzes, zu reduzieren, um damit Fang von untermaßigen Garnelen klein zu halten. Die Fischereiwirtschaft bemängelte jedoch, dass es dadurch zu Minderfängen käme und nicht alle Fischer, vor allem die ausländischen, einheitliche Netze verwendeten. Das Fazit des Projektes war ernüchternd:
„Die Auswertung der WSP-Daten zu den Maschenöffnungen der in der Fischerei verwendeten Steerte hat ergeben, dass die Flotte in den letzten etwa fünf Jahren unverändert und jahreszeitlich durchgängig mit nahezu gleich großen Maschenöffnung fischt. Diese sind alle legal und in der Mehrheit gleich oder größer, als es die MSC-Bestrebungen der Mehrheit der Fischer mit 20 mm Maschenöffnung vorgeben. Der Anteil von Maschenöffnungen unterhalb 20 mm ist jedoch weiterhin groß. Somit kann ein vorgezogener Effekt der Ergebnisse des Projektes CRANNET, die grundsätzlich größere Maschenweiten für die Bestände wie auch für die Ökonomie der Fischerei als vorteilhaft ausweisen, nicht festgestellt werden.“
Greenpeace klar auf Kurs
Greenpeace, sonst nicht zimperlich bei der Unterstützung der Offshore-Windkraftnutzung zu Lasten der Meeressäuger, war bei der Kritik am MSC und an der Grundschleppnetz-Fischerei klar auf Kurs:
„Greenpeace fordert das Marine Stewardship Council auf, die MSC-Kriterien so zu überarbeiten, dass das Siegel als überzeugendes Zeichen für eine ökologisch verantwortungsvolle und sozial verträgliche Fischerei steht: […[
- keine Zertifizierung von Produkten aus Fischereien, die eine hohe Beifangrate haben […]
- keine Zertifizierung von Produkten aus Fischereien, die zerstörerische Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben, sowie Grundschleppnetz- oder Tiefseefischereien […]“
Die Stiftung Meeresschutz sieht […] Intensive Grundschleppnetzfischerei in deutschen Meeresschutzgebieten:
„Eine Analyse von Satelliten-Tracking-Daten von Fischerbooten (über Global Fishing Watch) mit Schwerpunkt auf europäische Natura-2000-Gebiete offenbarte das Ausmaß des Fischereiaufwands mit Grundschleppnetzen. Im Jahr 2020 gehörten fünf deutsche Meeresschutzgebiete in der AWZ (Ausschließliche Wirtschaftszone) und im Küstenmeer (12-Meilen-Zone) zu den Top 10 der am stärksten in der EU mit Grundschleppnetzen befischten Gebieten. Auf Platz eins lag dabei ausgerechnet der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer mit über 730.000 Stunden! Platz zwei ging an das übrige Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete (über 576.000 Stunden). Auf dem dritten Platz landete schließlich das Schutzgebiet Sylter Außenriff, mit über 318.000 Stunden Befischung durch Grundschleppnetze. […]“ (Quelle hier)
Aus dem Wattenmeer nach Marokko: zum Pulen
Um die Krabben von den Schalen zu befreien und essbar zu machen, werden sie bis nach Marokko gefahren, dort gepult und dann zurück nach Europa zur Vermarktung gebracht. Damit die Tierchen nicht verderben, werden sie in Benzoesäure konserviert. Frisch und unkonserviert sind nur die Krabben, die direkt vom Kutter verkauft werden und die selbst gepult werden müssen. Das ZDF-Video aus 2014 dokumentiert dies in dem Bericht: Vorsicht Krabben
Die Kutter haben auch eine folkloristische Funktion, in den Sielorten sind sie der malerische Hintergrund für die Prospektidylle der Tourismusindustrie, ein Werbefaktor. Bemerkenswert ist die ständige Tourismuswerbung mit dem „Weltnaturerbe“, zu dem die Wattenmeer-Nationalparke auf Betreiben der Tourismuswirtschaft 2009 gekürt wurden, bemerkenswert ist aber auch, dass die damit verbundenen notwendigen Schutzinhalte eines Nationalparks weder von den Touristikern noch den Politikern wahrgenommen und vor allem auch nicht unterstützt werden. Es geht immer um die Übernachtungszahlen und die Touristenbespaßung, der Nationalpark und das „Weltnaturerbe“ sind nur noch wohlfeile Etiketten der Nutzer.
Inzwischen haben sich auch die Kurdirektoren an der ostfriesischen Nordseeküste geschlossen mit den Krabbenfischern solidarisiert. „Die Fischerei mit den typischen Krabbenkuttern sei ein Alleinstellungsmerkmal der Tourismusorte. Sollte das Verbot der Grundschleppnetze in Meeresschutzgebieten – wie in einem Aktionsplan der EU-Kommission vorgestellt – kommen und die Fischerei im niedersächsischen Wattenmeer eingestellt werden, hätte dies erkennbare Nachteile für den Tourismus“, heißt es in einer Presseerklärung. Zu einem Runden Tisch „Küstenfischerei“ hatten die CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann und Anne Janssen in Neuharlingersiel am 03. April eingeladen. Der Nationalpark Wattenmeer mit seinen Schutzzielen oder das „Weltnaturerbe“ waren nicht Gegenstand der stets eindimensionalen Presseberichterstattung.
Indes: Einige Kutterbetriebe erwägen bereits, vom Krabbenfang auf den Touristenfang umzustellen. Sie wollen Ausflugsfahrten ins Wattenmeer anbieten, sicherlich auch eine Perspektive, um am Massentourismus im Weltnaturerbe gewinnbringend teilzuhaben.
„Biodiversität“ ja, aber bitte nicht unter Wasser?
Es ist daher zu bezweifeln, dass sich diese Politiker jemals mit den negativen Auswirkungen der Grundschleppnetzfischerei auf die Artenvielfalt unter Wasser beschäftigt haben und sich zum Sprachrohr der Fischereiindustrie machen lassen. „Biodiversität“ ja, aber bitte nicht unter Wasser?
Das Schutzgebiet Wattenmeer ist die „Kinderstube“ einiger Fischarten. Der WWF fordert daher schon seit Jahrzehnten fangfreie Zonen im Wattenmeer zum Schutz der Jungfische vor dem Beifang, ohne dass man die gesamte Grundnetzfischerei verbieten müsste; alle Bemühungen dafür verliefen bisher im Sande.
Echter, fachlich begründeter Naturschutz, abgesehen von inhaltsleeren Sonntagsreden, war noch nie Handlungsgegenstand von Politikern, angefangen von den Ortsräten bis hinein in den Bundestag, noch nicht einmal von der grünen Partei. Das aktuelle Beispiel ist der Abbau der Naturschutz- und Planungsgesetzgebung der Ampel-Regierung für den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien mit der geplanten Vervierfachung der Windkraft-Anlagendichte in Deutschland. Dieser Rückschritt ist beispiellos und wird von der Partei der Grünen forciert und dominiert, die mit nur 14,8 Prozent der Stimmen 2021 in den Bundestag einzog.
Nach den Protesten gegen mögliche Fanggebietseinschränkungen rudert die EU-Kommission nun zurück. Es sei kein Gesetzentwurf für das Europaparlament in Vorbereitung. Vielmehr sei der Aktionsplan als Diskussionsgrundlage zu verstehen. Die Mitgliedsstaaten seien aufgefordert, bis März 2024 die Situation ihrer nationalen Gewässer und Fischfangflotten zu erfassen. Es gehe nicht darum, die Grundschleppnetzfischerei zu verteufeln, sondern ihre Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu reduzieren. Im Übrigen liege die Entscheidung, ob und wie in Meeresschutzgebieten gefischt werde, allein bei den EU-Mitgliedsstaaten, berichtete der Norddeutsche Rundfunk am 29. März 2023. Es bleibt also alles „wie gehabt“, zu Lasten des Meeresnaturschutzes. Die ewig lautstarken Naturschutz-Ignoranten haben voraussichtlich wieder einmal gewonnen. Dann darf man sich doch fragen, warum die EU-Kommission überhaupt das Papier der „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030“ vorgelegt hat.
Manfred Knake betreibt den Blog „Wattenrat.de“. Der „Wattenrat“ ist ein lockerer Zusammenschluss verbandsunabhängiger Naturschützer aus der Küstenregion Ostfrieslands, der aus der „Konferenz der Natur- und Umweltschutzverbände“ (gegründet 1979) hervorgegangen ist. Dieser Beitrag erschien zuerst dort.