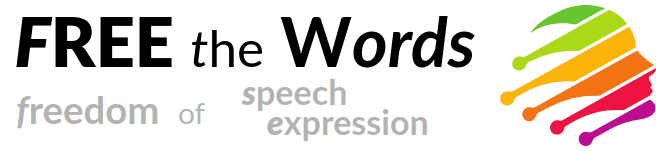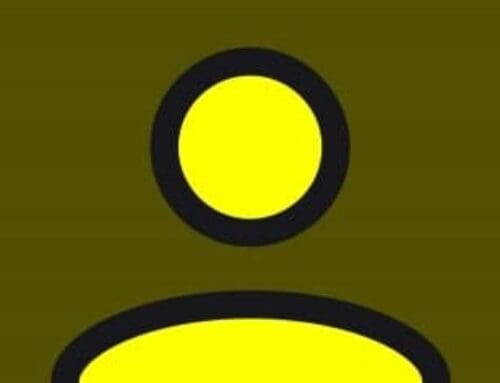Kultur-Kompass: „Der Betroffenheitskult“
„Und täglich grüßt das Murmeltier“: Der Kampf gegen „rechts“, Gefühle vor Fakten und die Angst vor einer drohenden Apokalypse. Es ist immer wieder dasselbe in unserer Gesellschaft. Sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen. Die Form ändert sich, aber der inhaltliche Kern bleibt gleich. Gewissermaßen befinden wir uns in einer ideologischen Dauerschleife.
Das wird hervorragend ersichtlich, wenn man sich abermals „Der Betroffenheitskult. Eine politische Sittengeschichte“ von Cora Stephan aus dem Jahre 1993 widmet. Obwohl Stephans Analysen fast dreißig Jahre alt sind, haben diese kaum an Aktualität eingebüßt. Zudem ist es heutzutage nicht so leicht eine populärwissenschaftliche Analyse auf diesem Niveau zu finden. Ganz obendrein eine, die allein aus der Feder des genannten Autors stammt. Ganz ohne Unterstützung eines Ghostwriters.
So präsentiert Stephan auf fast 200 Seiten, die sich in vier Kapitel aufteilen, nahezu eine Gesellschaftsanalyse des „Betroffenheitskultes“. Indem sie sich der Sentimentalisierung deutscher Politik widmet und einen Schnelldurchlauf durch die Jahre von 1986 bis 1989 in Deutschland vornimmt, präsentiert sie dem Leser gleich die Ursachen für typisch deutsche Untugenden. Vom ausgeprägten Gemeinschaftssinn bis hin zum gesinnungstreuen Denken und Handeln. Hierbei dürfen natürlich nicht der Rekurs auf soziologische Klassiker, wie Norbert Elias und Helmuth Plessner, fehlen.
Mit diesen Klassikern, und mit eigenen Beobachtungen im Gepäck, begibt sich Stephan in die Zeit des Ersten Golfkrieges. Dort widmet sie sich der beginnenden Sentimentalisierung sowie Politisierung in der deutschen Gesellschaft. Schon damals galt: „Daß Politiker nicht tun, was und wie sie sollen […].“ Oder: „Heute gelten umgekehrt Argument und Sachverhalt als das Obszöne: als Gefühlskälte, als vorgeschobenes Argument, als uneigentlich.“ Oder: „Man müsse Deutschland beständig unter der Quarantäne einer benevolenten Erziehungsdiktatur halten.“ Eigentlich wie heute. Es fehlen nur noch das Comeback der Schulterpolster, die Vokuhila-Frisur und ein Remake von Nenas „99 Luftballons“. Dann heißt es endgültig: „Welcome 80s“.
Skepsis gegenüber westlichen Werten
Hieran anschließend beschäftigt sich Stephan mit dem Zeitraum 1968 bis 1989. Hier zeigt sie, pointiert und sachkundig, woher Demokratieskepsis, Opferolympiade und eine „identifikatorischen Moral“ entstammen: Bereits nach der Neugründung der Bundesrepublik Deutschland herrschte eine weit verbreitete Skepsis gegenüber westlichen Werten, bei gleichzeitiger Sympathie für das sozialistische System der Deutschen Demokratischen Republik. Von ihren neuen emanzipatorischen Aufgaben überforderte Frauen (Hausfrau, Mutter und Zuverdienerin oder Verdienerin) klagten das Patriarchat an. Und „[die] identifikatorische Moral trägt zum Gefühl der Überlastung des Bürgers bei, der seine Seele mit allem Elend der Welt beladen wähnt.“
Die Fortsetzung und Steigerung dieser Einstellungen und Mentalitäten zeigt sich uns heutzutage nur allzu deutlich in Schlagworten wie „toxische Männlichkeit“, „Kampf gegen ‚rechts‘“ oder „Vielfalt“. Eben das verdeutliche, nach Stephan, ein „zu wenig am demokratischen Empfinden“, und bringt sie zum nächsten Thema ihres Buches. Dem deutschen Selbstverständnis.
Ihre Diagnose: Deutschland leide an einem nationalen Defizit. Zumindest der Westen Deutschlands. Während sich die DDR als legitime Nachfolgerin der „deutschen Kulturnation“ betrachtete, fehlte es der BRD an nationaler Identität. Dieses Vakuum füllten Anti-Faschismus, ein ideologischer Pazifismus und ein mit Ressentiments behafteter Anti-Amerikanismus, die sich alle gemeinsam in einem entgrenzten „Betroffenheitskult“ äußerten. Seit damals hat sich wenig geändert.
Wer somit die heutigen Entwicklungen, und den „Betroffenheitskult“, besser verstehen möchte, sollte unbedingt zur Lektüre greifen. Leicht verständlich und strukturiert bereitet Stephan dort komplexe Sachverhalte auf. Es ist Lesefreude pur, und zeigt: Alles bleibt irgendwie gleich. Um mit den Worten Stephans abzuschließen: „Und so sind und bleiben wir das Land, in dem die Sentimentalitäten bleiben: Politiker haben Gefühle, und Bürger sind betroffen“. Heißt es also auf ewig in Deutschland „Und täglich grüßt das Murmeltier“?
Stephan, Cora (1993). „Der Betroffenheitskult. Eine politische Sittengeschichte“. Berlin: Rowohlt.