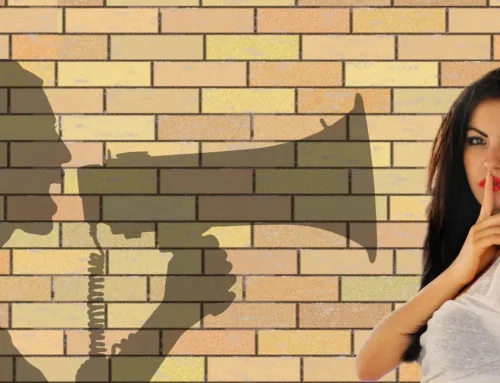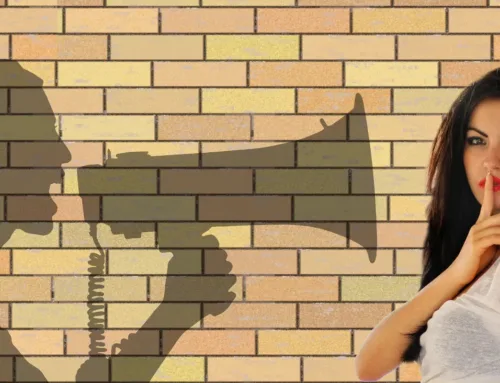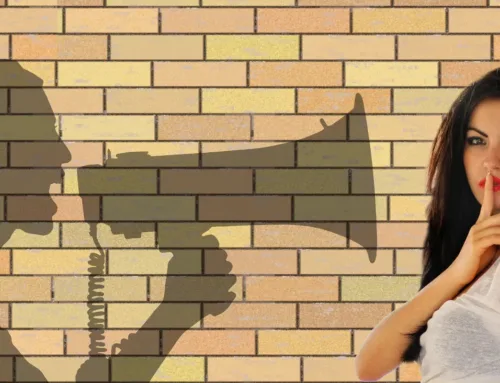«Behindertenorganisationen haben restlos versagt»
Veröffentlicht am 5. April 2023 von RL.
Barbara Müller machte sich während der «Pandemie» einen Namen als scharfe Kritikerin der Corona-Politik. Die SP warf die Thurgauer Kantonsrätin auch deshalb aus der Partei raus. Müller ist Geologin und leidet an einer Sehbehinderung. Am 24. März nahm sie an der ersten Behindertensession im Schweizer Parlament teil. Transition News sprach mit Müller über die Session, die mangelnde Anerkennung von Menschen mit Behinderungen, ihre juristischen Verfahren und ihre künftigen politischen Ambitionen.
Transition News: Frau Müller, unlängst machten Sie sich als Sprecherin für Menschen mit Behinderungen im Parlament stark. Wie ist es genau zur Session gekommen?
Barbara Müller: Federführend war der jetzige Bündner Mitte-Nationalratspräsident Martin Candinas. Er ist Mitglied der ehrenamtlichen Kantonalkommission von Pro Infirmis in Graubünden. Candinas hat das Ganze mit Mitte-Nationalrat Christian Lohr und der Mitte-Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller aufgegleist. Lohr ist der einzige Parlamentarier in Bern, der von einer Behinderung betroffen ist. Gemeinsam haben sie Menschen mit Behinderungen eingeladen – hauptsächliche Kantons- und Gemeinderäte, die daraufhin eine Kommission gebildet haben und die spätere Session organisiert haben.
Waren Sie auch Teil der Kommission?
Nein. Christian Lohr, den ich persönlich auch gut kenne, hatte mich dafür nicht eingeladen. Der Grund dürfte meine Kritik an den Corona-Massnahmen gewesen sein.
Was ist an der Session herausgekommen? War es eine reine Alibi-Übung?
Nein. In meinen Augen handelte es sich keinesfalls um eine Alibi-Übung. Alle Teilnehmer der Session waren sehr engagiert und standen voll hinter der Sache. Jeder und jede brachte seine Argumente mit in die Diskussion ein. Und die Resolution ist sehr allgemein gehalten.
Schrieben Sie auch mit an der Resolution?
Ja, ich wirkte unter anderem beim Inklusions-Paragraphen mit.
Die Inklusion steht in der Resolution im Zentrum.
Das ist so. Die Inklusion betrifft alle Lebensbereiche: Sport, alltägliches Leben, Politik und so weiter. Wir wollen als Menschen mit Behinderungen schliesslich ohne Hindernisse genauso am öffentlichen Leben teilhaben können wie alle anderen Menschen auch.
Die Resolution ist nun an den Präsidenten des National- und die Präsidentin des Ständerats gegangen. Sie klingt gut. Aber handelt es sich nicht um einen Papiertiger. Wird nun wirklich was geschehen und sich das Leben für Menschen mit Behinderungen hierzulande verbessern? Wie geht es nun weiter?
Natürlich kann die Resolution zunächst einmal als Papiertiger angesehen werden. Wichtig wäre, dass sie auch in entsprechende Gesetze und Verordnungen umgegossen würde. Es ist sicherlich noch viel zu tun. Wie es jetzt weitergeht, ist im Moment erstmal noch offen.
Wo sollte die Gesellschaft in Ihren Augen die Hebel ansetzen, sodass die Welt für Menschen mit Beeinträchtigungen eine bessere wird?
Heute werden Menschen mit Behinderungen vielfach gar nicht als Menschen wahrgenommen. Und zwar unabhängig davon, ob jemand eine sicht- oder unsichtbare Behinderung hat. Noch immer prägen Vorurteile das Bild, das wir von ihnen haben. Sie werden nicht als Menschen mit speziellen Fähigkeiten und Begabungen angesehen. Als Menschen wie Sie und ich. Dabei ist jeder Mensch einzigartig. Besonders schlimm finde ich: Sobald es offensichtlich ist, dass ein Mensch von einer Behinderung betroffen ist, wird oft behauptet: «Der kann ja sowieso nichts. Der ist zu nichts fähig.» Dabei werden auch die beruflichen Kompetenzen dieser Menschen rasch übersehen. Dies, obwohl viele von ihnen sogar einen Universitätsabschluss aufweisen. Trotzdem haben bestens ausgebildete Menschen mit Behinderungen nach wie vor grosse Probleme, einen Job zu finden.
Das Ganze hat viel mit dem Menschenbild zu tun….
Deshalb ist für mich klar: Der Fokus muss viel stärker auf die Stärken der Menschen gerichtet werden. Und nicht auf die Schwächen. Letzteres macht leider insbesondere die Invalidenversicherung (IV). Doch das ist ein grosser Fehler. Das ist Gift für die berufliche Integration.
Stichwort berufliche Integration: Ihre Kritik an der Invalidenversicherung (IV) halten Sie auch nicht hinter dem Berg. Was macht sie in Ihren Augen falsch?
Die IV sieht bloss immer die Defizite. Sie schaut nur auf das Negative. Das sagt schon der Begriff «invalid». Heisst, wer die IV benötigt, ist «wertlos», «minderwertig». Menschen mit Behinderungen werden so als «negativ» angesehen. Die Versicherung konzentriert sich immer nur darauf, was jemand nicht kann. Aber im Zentrum müssen die Stärken stehen. Die Frage muss lauten: Was kann der Mensch? Genau das macht die IV grundsätzlich falsch. Und dann kommt noch der Kantönligeist hinzu, der alles noch erschwert. Das bekam ich am eigenen Leibe zu spüren.
Die Sozialversicherung traute Ihnen nicht zu, im regulären Arbeitsmarkt tätig zu sein?
Ich selbst musste lange kämpfen, bis die IV mich meiner Arbeit nachgehen liess – ich bin promovierte Erdwissenschaftlerin und in der Forschung tätig. 17 Gerichtsprozesse gegen die IV Thurgau waren notwendig.
Wie ist so etwas möglich?
Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) ist derart komplex und ausufernd, dass es in der Praxis immer wieder zu Problemen führt. Zwar handelt es sich bei der IV um eine eidgenössische Versicherung. Trotzdem sind der Willkür Tür und Tor geöffnet. Denn jeder Kanton handhabt die Gesetze wieder unterschiedlich. Verantwortlich für die Willkür ist meiner Meinung nach der Kantönligeist. Zu mir kommen heute noch regelmässig Menschen, die sagen: «Was mache ich bloss, ich habe mit der IV-Stelle ein Problem.»
Sie plädieren anstelle der IV für eine Integrationsversicherung. Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem Kompetenzzentrum. Wie stellen Sie sich das vor?
Gegenwärtig hat jeder Kanton eine eigene IV-Stelle. Das ist gerade für kleinere Kantone ein Problem. Denn dort fehlt es häufig an Mitarbeitern, die auch das entsprechende Fachwissen mitbringen. Oftmals sind sie zu wenig kompetent, um mit den unterschiedlichsten Formen von Behinderungen adäquat umgehen zu können. Beim Grossteil der Menschen handelt es sich um psychisch behinderte Menschen. Aber es gibt auch ganz viele Menschen mit seltenen Behinderungen. Dazu zähle auch ich mit meiner Sehbehinderung. Zusätzlich kommt bei mir das Asperger-Syndrom hinzu. Gerade in kleinen Kantonen mangelt es bei der IV in diesen Bereichen oftmals an den entsprechenden Kompetenzen, die jedoch enorm wichtig sind. Die Mitarbeiter sollten über jede Form von Behinderung Bescheid wissen. Nur so kann eine berufliche Integration ermöglicht werden. Deshalb bin ich der Ansicht, dass Kompetenzzentren für unterschiedliche Arten von Behinderungen geschaffen werden müssen; Zentren, die sich auf spezifische Behinderungen spezialisieren. In diesen sollten gerade auch die Betroffenen stärker berücksichtigt werden. Sie müssen zwingend auch in die Abklärungen integriert werden. Doch das geschieht heute kaum. Dies auch aufgrund des Arguments, dass die Betroffenen dann möglichst viele Leistungen in Anspruch nehmen würden. So geht ein riesiges Know-how verloren.


Kantonsrätin Barbara Müller. Foto: zVg
Die heutige IV entscheidet also stets über die Köpfe hinweg?
Die Akten und Dossiers werden im Entscheidungsprozess viel zu stark berücksichtigt. Der einzelne Mensch wiederum viel zu wenig. Dabei sagen die Akten meist nichts aus über den Menschen. Ich kann von meinen Akten sagen: Mein Dossier hat inzwischen 5000 Seiten. Darin stehen teilweise schreckliche Aussagen drin, Aussagen, die als ehrverletzend eingestuft werden können. Das sage nicht ich, das sagen Juristen. So geht das nicht.
Ihr Fall ist sowieso ein spezieller. Heute ist nicht mehr die IV-Thurgau, sondern die IV-Zürich für Sie zuständig.
Nach 17 Prozessen in 15 Jahren musste der Kanton Thurgau mein Dossier an die IV Zürich übergeben. Das Ganze ist aufgrund des Drucks des Bundesamtes für Sozialversicherungen und des damaligen Regierungsrates im Kanton Thurgau geschehen. Seit Zürich zuständig ist, habe ich Ruhe. Im Kanton Zürich mache ich laut der IV-Stelle alles richtig, im Kanton Thurgau habe ich gemäss der dortigen IV-Stelle alles falsch gemacht.
Wie erklären Sie sich das?
In Zürich gibt es mehr kompetente und besser ausgebildete Mitarbeiter als in meinem Heimatkanton. Meine Anwälte, die mich im juristischen Streit mit der IV unterstützt hatten, sagten mir, dass es sich um eine persönliche Abrechnung mir gegenüber gehandelt habe. Das geht natürlich gar nicht. Das ist Willkür. Ich liess mich aber nie einschüchtern und machte stets von meinem Recht Gebrauch.
Anderes Thema: Sie plädieren für ein Parlament für Menschen mit Behinderungen. Wie stellen Sie sich das vor?
Ähnlich wie ein Jugendparlament, wo Vertreter von Menschen mit Behinderungen regelmässig zusammentreffen und Vorschläge einbringen können hinsichtlich Inklusion. Im Vordergrund muss stets die Frage stehen: Was gibt es noch zu verbessern, wo sind die Schwachstellen?
Sie selbst benutzen stets die Bezeichnung «Menschen mit Behinderungen» und nicht «Menschen mit Beeinträchtigungen». Ist diese Wortwahl nicht auch bereits grenzwertig?
Ich verwende beide Begriffe synonym. Für mich macht es keinen grossen Unterschied. Die Begriffe bezeichnen einen Zustand. «Behinderung» ist zwar eher negativ behaftet als «beeinträchtigt». Doch man muss auch sehen: Es ist nicht jeder für alles mögliche begabt. Nicht jeder wird ein Spitzensportler, wenn man die körperlichen Voraussetzungen dazu nicht mitbringt. Es geht auch nicht jeder studieren. Die einen sind eher handwerklich begabt, die andern kognitiv. Deshalb: Für mich macht es qualitativ keinen Unterschied. Früher sagte man «Behinderte», das geht für mich wiederum gar nicht. Denn wichtig ist: Es handelt sich um Menschen mit Behinderungen. Der Begriff mag vielleicht nicht sehr aussagekräftig erscheinen, aber er ist auch nicht diskriminierend.
Sie sind während Corona einem grösseren Publikum bekannt geworden, weil Sie die Corona-Politik der Regierung schonungslos kritisiert hatten. Wie beurteilten Sie die Arbeit der Behindertenorganisationen im Allgemeinen und während der Pandemie im Speziellen?
Es gibt ganz viele Organisationen, welche Menschen mit Behinderungen unterstützen. Sei es der Blindenverband, der Blindenbund, Organisationen, die Menschen mit Asperger unterstützen und so weiter. Das ist grundsätzlich gut. Doch ein grosses Problem, das ich in diesem Zusammenhang sehe: Bei diesen Organisationen sind vielfach nicht die Menschen mit Behinderungen an den Schalthebeln. In den Vorständen und Geschäftsstellen sitzen stets nichtbehinderte Menschen. Das ist eine reine Stellvertreterpolitik. Menschen mit Behinderungen müssen viel aktiver werden. Die Dinge selbst in die Hände nehmen. Nur dann kann es funktionieren. Wenn an den Schalthebeln nur Menschen sitzen, die nicht selbst betroffen sind, dann kommen wir nicht weiter. Oft lautet die Begründung: «Wir haben zu wenig Menschen mit Behinderungen, die sich engagieren wollen.» Ich kann von mir sagen: Ich wurde aufgrund meiner Kritik an der Corona-Politik von zwei Vereinen aus dem Vorstand ausgeschlossen. Was soll das? Wir Menschen mit Behinderungen sind selbst nicht einmal fähig, zu inkludieren. Auch deshalb kritisiere ich gerade auch die Vereine und Organisationen, die vorgeben, sich für Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Viele dieser Vereine haben während der Corona-Zeit nichts gemacht für die Betroffenen.
Können Sie Beispiele nennen?
Menschen mit Maskenattesten und Impfdispensen sind während der Pandemie wiederholt angegriffen worden. Man hat sie als «Verweigerer» bezeichnet. Dies, obwohl diese Menschen Gründe für ihr Verhalten hatten. Teilweise sind diese Menschen trotz einwandfreien Attesten verurteilt worden. Von den Behindertenorganisationen wurden sie dabei nicht unterstützt. Diese haben restlos versagt. Eine Ausnahme bildet die Organisation Inclusion Handicap, die gute Arbeit gemacht hat.
Sie haben auch so einige Erfahrungen mit den Justizbehörden gemacht…
Ich habe viel erlebt. Weil ich keine Maske getragen und mich geweigert hatte, ein Attest zu zeigen, sind mehrere laufende Verfahren hängig. In einigen Fällen bin ich schon freigesprochen worden. Gegenwärtig sind aber noch nicht alle Urteile rechtskräftig. Klar ist aber: Bisher wurde ich in keinem Verfahren verurteilt. Ich weiss von anderen Menschen mit Beeinträchtigungen, die verurteilt worden sind. Das ist eine Schande. Im Rahmen der Behindertensession habe ich in meiner kurzen Rede die Forderung aufgestellt, dass die noch hängigen Gerichtsverfahren gestoppt werden. Und in Fällen, wo Menschen mit Behinderungen wegen des Nichtragens einer Maske und ähnlichem verurteilt wurden, plädiere ich dafür, dass die Urteile für nichtig erklärt werden. Das wäre das Minimum.
Wie kam Ihre Forderung an?
Als ich diese Rede gehalten hatte sind mir die Leute aus dem Weg gegangen. Eine absolute Farce. Nicht einmal wir Menschen mit Behinderung können zusammenstehen.
Wie geht mit Ihnen politisch weiter: Kandidieren Sie via Aufrecht für den Nationalrat im Herbst?
Das ist möglich, gegenwärtig aber noch offen. Was ich aber bestimmt schon sagen kann: Für Aufrecht werde ich nicht kandidieren.
*******************
Dr. sc. nat. ETH Barbara Müller (*1963) ist Geologin und Mitglied des Thurgauer Kantonsrates.